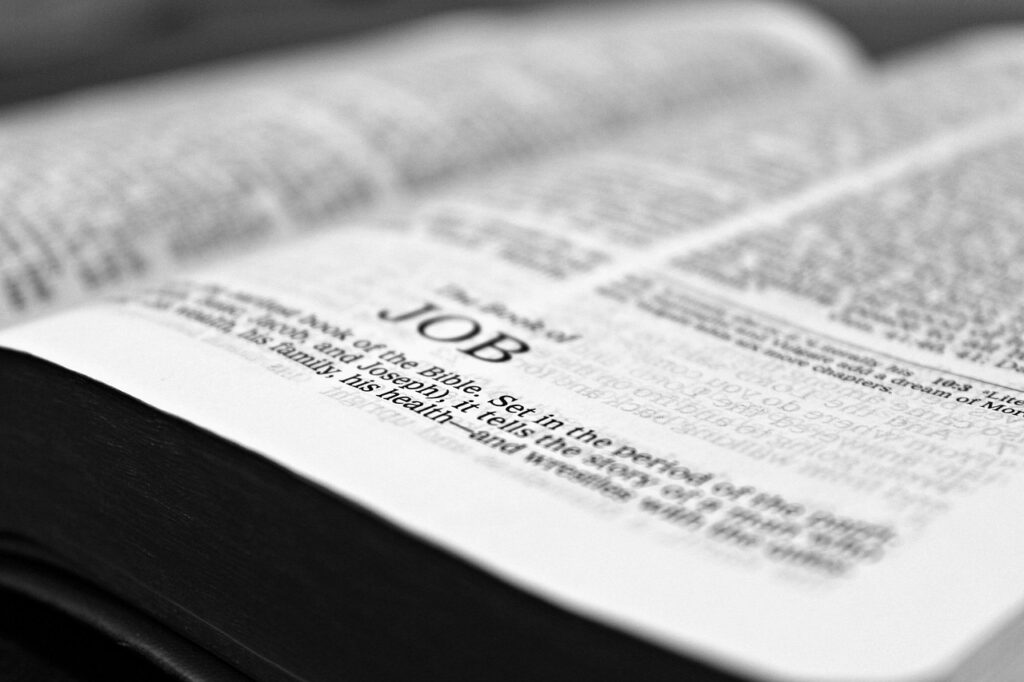Ein Arbeitszeugnis richtig verstehen zu können, ist für Eure berufliche Zukunft von zentraler Bedeutung. Während ein Zeugnis auf den ersten Blick positiv klingt, stecken hinter den freundlich klingenden Sätzen oft feine Unterschiede, die Personaler sofort erkennen. Arbeitgeber:innen sind verpflichtet, wahrheitsgemäß und wohlwollend zu formulieren. Genau diese Mischung hat zur berühmten „Zeugnissprache“ geführt – einem Code, den Ihr kennen müsst, wenn Ihr verstehen wollt, wie gut oder schlecht Ihr tatsächlich bewertet wurdet.
Arten und rechtlicher Anspruch
In Deutschland habt Ihr nach § 109 der Gewerbeordnung ein Recht auf ein schriftliches Arbeitszeugnis. Dabei gibt es zwei Formen:
- Einfaches Zeugnis: enthält nur Angaben zur Position und Beschäftigungsdauer.
- Qualifiziertes Zeugnis: enthält zusätzlich Bewertungen zu Leistung und Verhalten – und ist Standard bei Bewerbungen.
Das qualifizierte Zeugnis ist deshalb so wichtig, weil es nicht nur dokumentiert, was Ihr gemacht habt, sondern auch, wie Ihr es getan habt.
Aufbau eines qualifizierten Arbeitszeugnisses
Wer ein Arbeitszeugnis richtig verstehen möchte, muss den Aufbau kennen. Typisch sind folgende Bestandteile:
- Einleitung: persönliche Daten und Dauer der Beschäftigung.
- Tätigkeitsbeschreibung: detaillierte Auflistung der Aufgaben und Verantwortungen.
- Leistungsbewertung: Aussagen über Fachwissen, Arbeitsweise, Motivation, Belastbarkeit und Erfolge.
- Sozialverhalten: Einschätzung des Verhaltens gegenüber Vorgesetzten, Kolleg:innen und Kund:innen.
- Schlussformel: Dank, Bedauern, Zukunftswünsche – oder das Fehlen dieser Formeln als stiller Hinweis.
„Ein fehlender Abschnitt im Arbeitszeugnis ist selten ein Versehen, sondern oft ein Signal, das erfahrene Personaler sofort deuten.“ – Redaktion
Fachliteratur hilft dabei, ein Arbeitszeugnis richtig zu verstehen: Das Buch „Arbeitszeugnisse in Textbausteinen“ erklärt Inhalte, Formulierungen und rechtliche Grundlagen.
Die Zeugnissprache entschlüsseln
Einige Worte entscheiden über die Note. Kleine Nuancen wie „voll“ und „vollst“ können Welten bedeuten.
Tabelle: Typische Formulierungen und ihre Bedeutung
| Formulierung | Note / Bedeutung |
|---|---|
| „stets zu unserer vollsten Zufriedenheit“ | Sehr gut (Note 1) |
| „stets zu unserer vollen Zufriedenheit“ | Gut (Note 2) |
| „zu unserer vollen Zufriedenheit“ | Befriedigend (Note 3) |
| „zu unserer Zufriedenheit“ | Ausreichend (Note 4) |
| „war stets bemüht, den Anforderungen …“ | Mangelhaft (Note 5) |
Neben dieser Skala gibt es weitere verschlüsselte Hinweise.
- „War bemüht“: Er oder sie hat es nicht geschafft.
- „Gesellig“: häufig abgelenkt oder zu viel im Pausenraum.
- „Korrekt“: eher kühl und distanziert.
- „Zeigte Verständnis“: passiv, wenig Eigeninitiative.
- „Hat sich im Rahmen seiner Möglichkeiten eingesetzt“: deutliche Abwertung.
Sozialverhalten richtig lesen
Das Verhalten im Team ist ein zentraler Bestandteil. Ein Satz wie „ihr Verhalten war stets einwandfrei“ ist Bestnote. Formulierungen wie „ihr Verhalten war korrekt“ oder „im Wesentlichen beanstandungsfrei“ deuten dagegen auf Probleme hin.
Auch die Reihenfolge spielt eine Rolle:
- Standard: „gegenüber Vorgesetzten, Kolleg:innen und Kund:innen“
- Auffällig: Wenn Kund:innen vor Vorgesetzten genannt werden – das deutet auf Schwierigkeiten mit Führungskräften hin.
Die Schlussformel – oft entscheidend
Die Schlussformel ist kein Pflichtteil, aber sie wird von Personalern besonders genau gelesen. Optimal ist ein Satz, der Dank, Bedauern und gute Wünsche kombiniert.
- Sehr positiv: „Wir bedauern ihr Ausscheiden, danken herzlich und wünschen weiterhin viel Erfolg.“
- Neutral: „Wir wünschen für die Zukunft alles Gute.“
- Negativ: Fehlt Dank oder Bedauern, ist das fast immer ein stilles Warnsignal.
Beispiele aus der Praxis
- Sehr gut: „Sie erledigte ihre Aufgaben stets zu unserer vollsten Zufriedenheit und brachte das Team entscheidend voran.“
- Durchschnittlich: „Er führte die ihm übertragenen Aufgaben zu unserer vollen Zufriedenheit aus.“
- Negativ codiert: „Sie war stets bemüht, ihre Aufgaben zu erfüllen.“
Rechte und Handlungsoptionen
Wenn Ihr Euer Arbeitszeugnis richtig versteht und Unstimmigkeiten bemerkt, solltet Ihr aktiv werden. Zunächst lohnt sich ein Gespräch mit der Personalabteilung. Oft ist Spielraum für Formulierungen vorhanden, und mit freundlichen, konkreten Vorschlägen lässt sich viel erreichen.
Wenn das nicht hilft, könnt Ihr schriftlich eine Korrektur beantragen. Bleibt der Arbeitgeber stur, bleibt nur der Rechtsweg. Wichtig ist die Frist: In der Regel müsst Ihr innerhalb von drei Wochen reagieren, sonst verliert Ihr den Anspruch.
Tipps für die Praxis
So prüft Ihr ein Zeugnis professionell und vermeidet Missverständnisse:
- Achtet auf kleine Wörter wie „voll“ vs. „vollst“.
- Prüft den Gesamteindruck: Länge, Vollständigkeit, Glaubwürdigkeit.
- Hinterfragt fehlende Inhalte – manchmal sind sie bewusst ausgelassen.
- Nutzt Vergleiche mit Mustern oder veröffentlichten Vorlagen.
- Holt Euch Expertenrat – Fachanwälte oder Karriereberater sehen oft sofort, was zwischen den Zeilen steht.
Die Zukunft der Arbeitszeugnisse
Mit der Digitalisierung verändern sich auch Arbeitszeugnisse. Immer häufiger werden sie elektronisch ausgestellt. Bereits heute gibt es Tools, die automatisch die Formulierungen bewerten und in Noten umwandeln. Während in Deutschland die codierte Sprache bestehen bleibt, sind in anderen Ländern wie der Schweiz oder Österreich die Formulierungen oft direkter.
FAQ – Arbeitszeugnis richtig verstehen
Was bedeutet „stets zu unserer vollen Zufriedenheit“?
Das ist eine gute Bewertung (Note 2). Für ein sehr gut müsste „vollsten“ stehen.
Wie erkenne ich versteckte Kritik?
An Worten wie „bemüht“, „korrekt“ oder an übertrieben knappen Passagen.
Kann ich ein schlechtes Zeugnis ändern lassen?
Ja, Ihr habt das Recht auf ein faires Zeugnis und könnt Korrekturen einfordern.
Wie wichtig ist die Schlussformel?
Sehr wichtig. Ihr Fehlen gilt fast immer als Negativsignal.
Ist ein einfaches Zeugnis ausreichend?
Nein, für Bewerbungen ist immer ein qualifiziertes Zeugnis notwendig.
Wie lange sollte ein Arbeitszeugnis sein?
Für kurze Beschäftigungen eine Seite, für mehrere Jahre zwei bis drei Seiten.
Welche Unterschiede gibt es international?
In Österreich sind Zeugnisse kürzer, in der Schweiz direkter. Nur in Deutschland ist die codierte Sprache so etabliert.